Thermodynamik
Zustandsgleichung idealer Gase; Universelle Gasgleichung; Wärmekapazität; Volumenarbeit; Innere Energie; Zustandsänderungen; Reale Gase; Entropie; Hauptsätze; Kreisprozesse; Thermischer Wirkungsgrad; Wärmekraftmaschine; Motoren; Gasturbine; Kältemaschine
Jetzt mit Spaß die Noten verbessern
und sofort Zugriff auf alle Inhalte erhalten!
30 Tage kostenlos testenInhaltsverzeichnis zum Thema
- Gasgesetze
- Hauptsätze der Thermodynamik
- Erster Hauptsatz der Thermodynamik (Wärmelehre)
- Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik (Wärmelehre)
- Entropie
Gasgesetze
Der physikalische Zustand eines Gases lässt sich mit den Grundgrößen Druck, Volumen, Temperatur beschreiben. Es gilt das Gasgesetz:
$p \cdot V=n \cdot R \cdot T$.
Folgt ein Gas genau dem Gasgesetz , so handelt es sich um ein ideales Gas, andernfalls um ein reales Gas. Bei der der Modellvorstellung des idealen Gases besitzen die Teilchen punktförmige Massen, sie führen inelastische Stöße aus und besitzen nur eine geringe Dichte. Hältst du in dem Gasgesetz bestimmte Zustandsgrößen konstant, kannst du Zusammenhänge aufstellen, die in verschiedenen Gesetzen der Thermodynamik festgehalten sind.
- Für eine konstante Temperatur T gilt das Gesetz von Boyle-Mariotte: p~1/V.
- Wenn du den Druck p konstant hältst, kommst du auf das Gesetz von Charles: V~T.
- Für ein konstantes Volumen ergibt sich das Gesetz von Gay-Lussac: p~T.
Hauptsätze der Thermodynamik
Es gibt drei Hauptsätze der Thermodynamik. Diese Sätze sind Regeln, nach denen sich Wärmeenergie und innere Energie verändern.
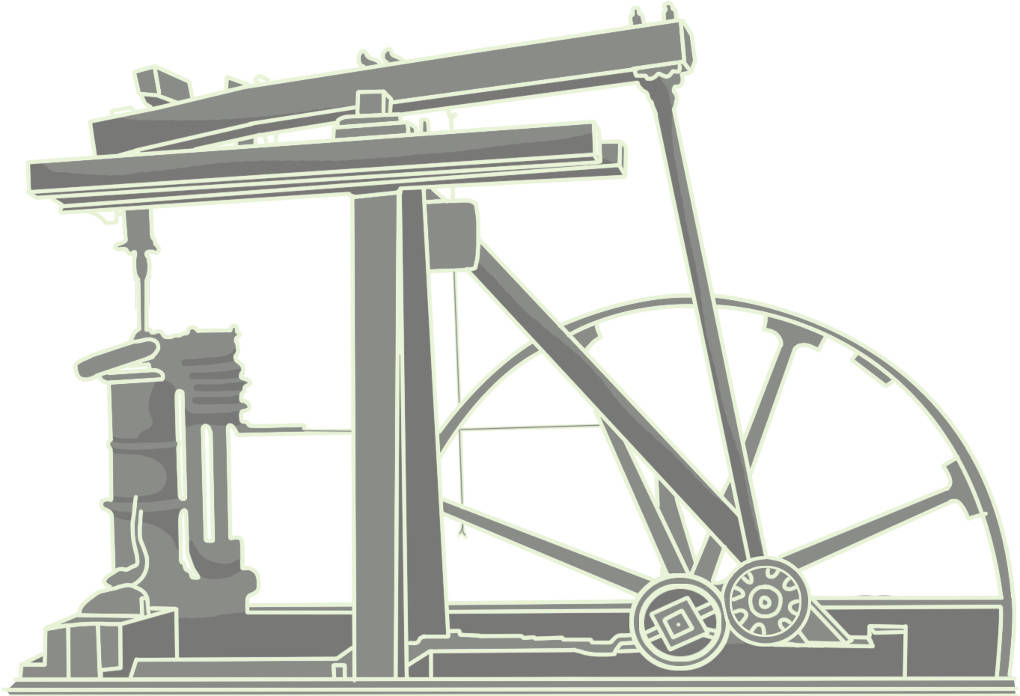
Erster Hauptsatz der Thermodynamik (Wärmelehre)
Der erste Hauptsatz der Thermodynamik bestimmt, welche Prozesse in einem isolierten, also abgeschlossenen, System möglich sind. Der zweite Hauptsatz gibt an, in welche Richtung diese Prozesse ablaufen. Der erste Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass wenn einem thermisch isolierten System von außen eine Wärmemenge Q zugeführt wird, diese die innere Energie des Systems erhöht. Das System kann nach außen Arbeit abgeben. Dabei gilt der Satz von der Erhaltung der Energie:
$Q=\Delta U - W$
Eine Konsequenz aus dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik besteht darin, dass kein Perpetuum mobile 1. Art existiert. Das heißt, es gibt keine Maschine, die dauernd Arbeit verrichtet, ohne eine gleichgroße Energiemenge aufzunehmen. Ein Perpetuum mobile 2. Art wäre eine Maschine, die mechanische Arbeit dadurch leistet, dass sie einem Wärmevorrat eine bestimmte Wärmemenge entzieht. Diese existiert entsprechend des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik nicht.
Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik (Wärmelehre)
Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass ein System nie spontan in einen erheblich unwahrscheinlicheren Zustand übergeht, das heißt, bei jeder Zustandsänderung wächst die Entropie S oder sie bleibt gleich. Eine andere Formulierung des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik lautet: Wärme kann nicht von selbst aus von einem kälteren in einen wärmeren Körper übergehen.
Eine Folgerung aus dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik lautet, dass es kein Perpetuum mobile 2. Art gibt. Das bedeutet, es gibt keine periodisch arbeitende Maschine, die nichts weiter bewirkt als die Abkühlung eines Wärmereservoirs und die Hebung einer Last.
Entropie
Die Entropie $S$ ist eine Zustandsgröße der Thermodynamik und beschreibt ein Maß für die Umkehrbarkeit von thermodynamischen Vorgängen. Man könnte die Entropie auch als ein Maß der Unordnung oder als ein Maß der Energieentwertung verstehen. Bringt man zwei Volumina unterschiedlicher Gase zusammen, so vermischen sie sich vollständig und es ist äußerst unwahrscheinlich, dass sie sich wieder entmischen. Es bleibt aber grundsätzlich möglich , denn die Gasmoleküle bewegen sich regellos und könnten sich prinzipiell wieder in ihren Ausgangsvolumina ansammeln. Die Entropie wird eingeführt, um die Verlaufsrichtung praktisch irreversibler Prozesse zu beschreiben. Dabei gilt: Ein abgeschlossenes System ändert sich so lange, bis es den Zustand größter Wahrscheinlichkeit angenommen hat.
Die thermodynamische Definition der Entropie lautet:
$\Delta S=\frac{\Delta Q}{T}$
Die Entropiedifferenz zweier (thermodynamisch) nahe benachbarter Zustände entspricht der Differenz der Wärmeenergien dieser beiden Zustände bei reversiblem Übergang.
Alle Videos und Lerntexte zum Thema
Videos und Lerntexte zum Thema
Thermodynamik (14 Videos, 4 Lerntexte)
Alle Arbeitsblätter zum Thema
Arbeitsblätter zum Thema
Thermodynamik (12 Arbeitsblätter)
-
 Gasgesetz – Temperatur, Druck, Volumen
PDF anzeigen
Gasgesetz – Temperatur, Druck, Volumen
PDF anzeigen -
 Temperatur, Druck, Volumen (Das Gasgesetz)
PDF anzeigen
Temperatur, Druck, Volumen (Das Gasgesetz)
PDF anzeigen -
 Spezifische Wärmekapazität eines idealen Gases
PDF anzeigen
Spezifische Wärmekapazität eines idealen Gases
PDF anzeigen -
 Erster Hauptsatz der Thermodynamik
PDF anzeigen
Erster Hauptsatz der Thermodynamik
PDF anzeigen -
 Erster Hauptsatz der Wärmelehre
PDF anzeigen
Erster Hauptsatz der Wärmelehre
PDF anzeigen -
 Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik
PDF anzeigen
Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik
PDF anzeigen -
 Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik
PDF anzeigen
Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik
PDF anzeigen -
 Thermodynamisches System
PDF anzeigen
Thermodynamisches System
PDF anzeigen -
 Reale Gase
PDF anzeigen
Reale Gase
PDF anzeigen -
 Universelle Gasgleichung
PDF anzeigen
Universelle Gasgleichung
PDF anzeigen -
 Entropie – Einführung
PDF anzeigen
Entropie – Einführung
PDF anzeigen -
 Entropie
PDF anzeigen
Entropie
PDF anzeigen
Beliebteste Themen in Physik
- Temperatur
- Schallgeschwindigkeit
- Dichte
- Drehmoment
- Transistor
- Lichtgeschwindigkeit
- Elektrische Schaltungen – Übungen
- Galileo Galilei
- Rollen- Und Flaschenzüge Physik
- Radioaktivität
- Aufgaben zur Durchschnittsgeschwindigkeit
- Lorentzkraft
- Beschleunigung
- Gravitation
- Ebbe und Flut
- Hookesches Gesetz Und Federkraft
- Elektrische Stromstärke
- Elektrischer Strom Wirkung
- Reihenschaltung
- Ohmsches Gesetz
- Freier Fall
- Kernkraftwerk
- Reflexionsgesetz: Ebener Spiegel – Übungen
- Was sind Atome
- Aggregatzustände
- Infrarot, Uv-Strahlung, Infrarot Uv Unterschied
- Isotope, Nuklide, Kernkräfte
- Transformator
- Lichtjahr
- Si-Einheiten
- Fata Morgana
- Gammastrahlung, Alphastrahlung, Betastrahlung
- Kohärenz Physik
- Mechanische Arbeit
- Schall
- Elektrische Leistung
- Dichte Luft
- Ottomotor Aufbau
- Kernfusion
- Trägheitsmoment
- Heliozentrisches Weltbild
- Energieerhaltungssatz Fadenpendel
- Linsen Physik
- Ortsfaktor
- Interferenz
- Diode und Photodiode
- Wärmeströmung (Konvektion)
- Schwarzes Loch
- Frequenz Wellenlänge
- Elektrische Energie






























