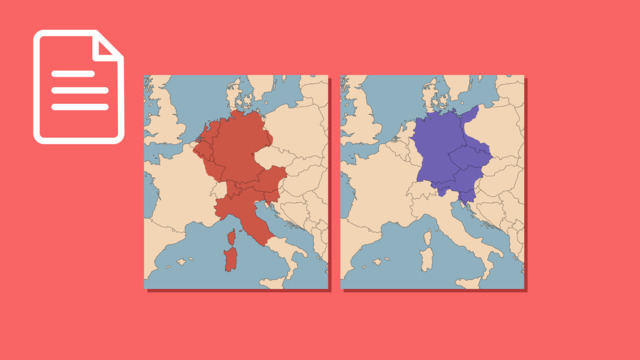Was ist eine historische Quelle?
Eine historische Quelle liefert wertvolle Informationen über vergangene Epochen. Du kannst zwischen Sachquellen, Textquellen und Bildquellen unterscheiden. Jede Quelle erzählt ihre eigene Geschichte. Neugierig geworden? Lies weiter und entdecke die Vielfalt der Quellen!
- Spurensuche – woher wissen wir etwas über die Vergangenheit?
- Die Quellen unseres geschichtlichen Wissens
- Sachquellen
- Textquellen
- Bildquellen
- Mündliche Überlieferungen und Zeitzeugen
in nur 12 Minuten? Du willst ganz einfach ein neues
Thema lernen in nur 12 Minuten?
-
 5 Minuten verstehen
5 Minuten verstehen
Unsere Videos erklären Ihrem Kind Themen anschaulich und verständlich.
92%der Schüler*innen hilft sofatutor beim selbstständigen Lernen. -
 5 Minuten üben
5 Minuten üben
Mit Übungen und Lernspielen festigt Ihr Kind das neue Wissen spielerisch.
93%der Schüler*innen haben ihre Noten in mindestens einem Fach verbessert. -
 2 Minuten Fragen stellen
2 Minuten Fragen stellen
Hat Ihr Kind Fragen, kann es diese im Chat oder in der Fragenbox stellen.
94%der Schüler*innen hilft sofatutor beim Verstehen von Unterrichtsinhalten.

Lerntext zum Thema Was ist eine historische Quelle?
Spurensuche – woher wissen wir etwas über die Vergangenheit?
Im Unterrichtsfach Geschichte lernst du, wie Menschen in früheren Zeiten gelebt haben. Du erfährst zum Beispiel, wie im Alten Ägypten Pyramiden gebaut wurden, wie die Menschen im Mittelalter auf Burgen lebten und dass zur Zeit der Industrialisierung die Dampfmaschine erfunden wurde. Doch woher wissen wir diese Dinge über die Vergangenheit eigentlich? Um Informationen über die Geschichte der Menschheit zu gewinnen, begeben sich Historikerinnen und Historiker regelmäßig auf „Spurensuche“. Denn Spuren und Überreste aus der Vergangenheit gibt es in ganz vielen verschiedenen Formen. Sie können ganz groß sein, wie zum Beispiel die „Porta Nigra“, das „schwarze Tor“ der Römer in Trier.
| Porta Nigra |
|---|
 |
Sie können aber auch ganz klein sein. So wie die hier abgebildete römische Münze aus der Antike, die auf der einen Seite einen römischen Herrscher, Kaiser Trajan, und auf der anderen Seite den Gott Neptun zeigt.
| Vor- und Rückseite einer römischen, antiken Münze |
|---|
 |
„Überreste“ aus der Vergangenheit, die uns Informationen über die Zeit, in der sie entstanden sind, oder auch die Zeit, in der sie zum Einsatz kamen, geben, werden in dem Fach Geschichte „Quellen“ genannt. Du kannst dir das so vorstellen: So wie das Wasser eines Bachs aus einer Quelle strömt und sich seinen Weg durch die Landschaft bahnt, fließt auch das Wissen, das Historikerinnen und Historiker über die Vergangenheit gewinnen können, aus erhaltenen Überresten früherer Zeiten in unsere heutige Zeit. Quellen spielen daher in der Geschichtswissenschaft und auch im Geschichtsunterricht eine ganz wichtige Rolle.
Quellen: Überreste aus der Vergangenheit, wie Briefe, andere Texte, Bilder, Gebäude, Werkzeuge usw., durch die wir Informationen über frühere Zeiten erhalten
Die Quellen unseres geschichtlichen Wissens
Wenn sich Historikerinnen und Historiker mit der Geschichte beschäftigen, dann stellen sie ganz bestimmte Fragen an die Vergangenheit. Zum Beispiel:
- Was genau ist geschehen?
- Warum ist es so passiert?
- Wie haben Menschen in jener Epoche gelebt?
- Welchen Zusammenhang gibt es zwischen der Vergangenheit und unserer heutigen Gesellschaft?
Um solche Leitfragen zu beantworten, arbeiten sie mit Quellen. Weil Quellen sehr unterschiedlich sein können, werden sie in verschiedene Gattungen unterteilt: Es gibt Sachquellen, Textquellen und Bildquellen.
Sachquellen
Was kannst du dir unter einer Sachquelle vorstellen? Zum Beispiel das Römertor in Trier oder die römische Münze, die wir uns schon angeschaut haben! Sachquellen sind Gegenstände und Bauwerke, die, aus vergangenen Zeiten übrig geblieben sind – mal besser und mal schlechter erhalten. Dazu zählen Funde wie Kleidung, Werkzeuge, Schmuck und Waffen, also Alltagsgegenstände aus der Vergangenheit. Aber auch Überreste der Menschen selbst wie Knochen oder mumifizierte Leichname können als Quellen dienen. Gerade für die Ur- und Frühgeschichte der Menschheit gibt es fast nur Sachquellen. Hier ist die Arbeit der Historikerinnen und Historiker eng mit der von Archäologinnen und Archäologen verbunden, die mit ihren Ausgrabungen Quellen zum Vorschein bringen, die dann auch von der Geschichtswissenschaft ausgewertet werden können.
Eine besondere Stellung unter den Sachquellen nehmen die Bauwerke ein: Tempel, Mauern, Kirchen, Wohnhäuser und Bauten aller Art aus unterschiedlichsten Epochen prägen häufig heute noch das Stadtbild in verschiedenen Orten überall auf der Welt. Nicht selten sind solche Bauwerke beliebte Touristenattraktionen!
| Pyramide des Kukuclán | Chinesische Mauer | Parthenon-Tempel |
|---|---|---|
 |
 |
 |
Textquellen
Textquellen bzw. schriftliche Quellen sind für die historische Forschung besonders wichtig und werden dir auch im Geschichtsunterricht immer wieder begegnen. Eine Textquelle ist etwas, das in der Vergangenheit von irgendjemandem aufgeschrieben wurde. Vielleicht kommt dir hier direkt ein typischer Text in den Sinn, wie du ihn aus der Schule kennst, zum Beispiel aus einem Sachbuch. Texte können allerdings in ganz unterschiedlichen Formen auftreten und wurden im Lauf der Geschichte auf vielen verschiedenen Materialien festgehalten. Ein Text aus der Vergangenheit kann so zum Beispiel ein Bericht, ein Brief, ein Vertrag oder auch eine aufgeschriebene Rede sein. Er kann in Stein gemeißelt, auf Ton und Wachs geschrieben oder in Metall gestanzt sein. Eine lange Zeit wurden Texte fast ausschließlich zu Papier gebracht, heutzutage sind viele Textquellen digital und mithilfe des Internets und eines Laptops abrufbar.
| Keilschrift der Sumerer |
|---|
 |
Bildquellen
Auch Bilder können sehr viele Informationen über die Vergangenheit für uns bereithalten. Gemalt und gezeichnet haben Menschen schon vor sehr langer Zeit. Sehr bekannt sind zum Beispiel Höhlenmalereien, die schon in der Steinzeit angefertigt wurden. Später wurden Bilder auf Vasen, auf Häuserwänden, auf Papier und auf Leinwand angefertigt. Diese Darstellungen zeigen uns einerseits viel über die vergangenen Zeiten, die in ihnen widergespiegelt werden, und verraten uns andererseits auch eine Menge über die Menschen, die sie gezeichnet oder gemalt haben.
| Höhlenmalerei aus der Steinzeit | Griechische Vase | Ägyptische Wandmalerei |
|---|---|---|
 |
 |
 |
Für die jüngere Geschichte spielen außerdem Fotografien und schließlich auch Filme sowie Videoaufnahmen eine immer wichtigere Rolle. Diese scheinen auf den ersten Blick eine sehr realitätsnahe Abbildung von vergangenen Ereignissen zu ermöglichen Trotzdem ist es, wie bei allen anderen Arten von Quellen auch, sehr wichtig, diese kritisch einzuordnen und sie mit ihrem historischen Kontext abzugleichen.
Mündliche Überlieferungen und Zeitzeugen
Zu guter Letzt sollte an dieser Stelle auch die mündliche Überlieferung als Sonderfall historischer Quellen genannt werden. Du hast bestimmt auch schon Geschichten „von früher“ von deinen Eltern oder Großeltern erzählt bekommen. Bei verschiedenen Anlässen, wie zum Beispiel auf einer Familienfeier, erinnern sich ältere Menschen mit einem großen Erfahrungsschatz gelegentlich an „alte Zeiten“ und berichten von ihren Erlebnissen. In diesem Moment werden sie gewissermaßen zu einer mündlichen Quelle über die Vergangenheit.
In der Geschichtswissenschaft werden sie deshalb auch „Zeitzeugen“ genannt: Ähnlich wie ein Zeuge in einem Kriminalfall haben Zeitzeugen ein historisches Ereignis miterlebt („bezeugt“), das vielleicht einige Jahrzehnte in der Vergangenheit liegt, wie zum Beispiel den Mauerfall in Deutschland. Da Zeitzeugen aus erster Hand über historische Ereignisse berichten können, werden sie häufig von Historikerinnen und Historikern befragt, die über diese Ereignisse Nachforschungen anstellen. Auch bei Zeitzeugen ist es aber sehr wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass diese immer nur ihre eigene Perspektive auf vergangene Geschehnisse wiedergeben können. Diese individuelle, persönliche Sicht auf die Vergangenheit darf nicht mit einer vermeintlichen allgemeingültigen Wahrheit verwechselt werden.
Quellen auswerten
Wie wir gesehen haben, gibt es sehr viele unterschiedliche Quellenarten, die Informationen über vergangene Zeiten für uns bereithalten. Es ist aber auch schon deutlich geworden, dass diese Informationen nicht einfach abgelesen oder übernommen werden können, Historikerinnen und Historiker müssen sie sich erarbeiten. Um neue Kenntnisse über die Vergangenheit zu erlangen, ziehen sie Quellen heran und beurteilen diese kritisch, um den Wert und die Aussagen einer Quelle besser einschätzen zu können. Diese Methode wird in der Geschichtswissenschaft Quellenkritik genannt.
Im Umgang mit Quellen ist es besonders wichtig, die richtigen Fragen zu stellen. Typische Fragen sind zum Beispiel:
- Welche Art von Quelle habe ich vor mir?
- Wann und wie ist die Quelle entstanden?
- Wie lässt sich die Quelle beschreiben?
- Wozu diente die Quelle und welche Bedeutung hatte sie für ihre Zeitgenossen?
- Was verrät uns die Quelle über ihre Entstehungszeit?
Dieses Vorgehen, bei dem gezielt Fragen an das Quellenmaterial gestellt wird, nennen wir „analysieren“.
Quellen und Darstellungen – der Unterschied
Wenn Historikerinnen und Historiker Quellen untersucht und ausgewertet haben, dann schreiben sie darüber. Die Texte, die sie so verfassen, nennen wir Darstellungen. Darstellungen können wissenschaftliche Texte, aber auch historische Romane, Bilder, Spiele und Filme mit historischen Inhalten sein. Wir können also zwischen Darstellungen aus der Wissenschaft und Darstellungen aus der Geschichtskultur unterscheiden. Gemeinsam haben sie, dass sie etwas, das über die Vergangenheit herausgefunden wurde, neu darstellen und mit einem gewissen zeitlichen Abstand zu dem dargestellten historischen Inhalt erstellt wurden. Das unterscheidet sie von Quellen, die direkt aus der Zeit stammen, über die sie Informationen enthalten.
Darstellungen: Erzählungen über die Vergangenheit, die sich auf Quellen aus der jeweiligen Zeit stützen können und, im Fall von wissenschaftlichen Darstellungen, den Methoden der Geschichtswissenschaft folgen
Deshalb sind zum Beispiel auch die Erklärtexte in deinem Geschichte-Schulbuch Darstellungen. Darstellungstexte, die in erster Linie informieren sollen, beschreiben historische Ereignisse und Entwicklungen und versuchen, diese zu erklären und zu erläutern. Auch wenn zwei Darstellungstexte zum gleichen Thema die gleichen Quellen als Informationsgrundlage haben, können sie sich in ihren Aussagen unterscheiden. Das liegt daran, dass jede forschende Person mit ihren eigenen Fragen und der persönlichen Perspektive an historischen Quellen arbeitet und so immer auch unterschiedliche Schlussfolgerungen und Urteile möglich sind.
Was ist eine historische Quelle? – Zusammenfassung
Als Überreste aus der Vergangenheit helfen uns Quellen dabei, die Vergangenheit zu rekonstruieren und so Geschichte zu schreiben.
Einen Überblick über die verschiedenen Arten von Quellen (Quellengattungen) siehst du in dieser Tabelle:
| Sachquellen | Textquellen | Bildquellen |
|---|---|---|
| Knochen, Werkzeuge, Münzen, historische Gebäude, Mauerreste usw. | Inschriften, Briefe, Bücher, Flugblätter, digitale Texte usw. | Zeichnungen, Gemälde, Karten, Fotos, Filme usw. |
Häufig gestellte Fragen zum Thema Was ist eine historische Quelle?
Was ist eine historische Quelle? Übung
-
Was sind historische Quellen?
TippsDas gesamte heutige Wissen über die Geschichte der Menschheit beruht auf Quellen.
LösungEs handelt sich um Überreste aus der Vergangenheit, aus denen wir Informationen über frühere Zeiten erhalten.
-
Sachquelle, Textquelle oder Bildquelle?
TippsZu jeder Kategorie gehören drei Quellen.
LösungSachquellen:
- Mauerreste
- Knochen
- Münzen
- Briefe
- Inschriften
- verschriftlichte Reden
- Fotos
- Gemälde
- Höhlenmalereien
-
Was ist der Unterschied zwischen einer Quelle und einer Darstellung?
TippsSowohl Quellen als auch Darstellungen halten für uns Informationen bereit. Sie unterscheiden sich aber normalerweise im Entstehungszeitraum und in der Absicht, die hinter ihrer Erstellung steht.
LösungWenn Historikerinnen und Historiker Quellen untersucht und ausgewertet haben, dann schreiben sie darüber. Die Texte, die sie so verfassen, nennen wir Darstellungen. Darstellungen können wissenschaftliche Texte, aber auch historische Romane, Bilder, Spiele und Filme mit historischen Inhalten sein. Wir können also zwischen Darstellungen aus der Wissenschaft und Darstellungen aus der Geschichtskultur unterscheiden.
Gemeinsam haben sie, dass sie etwas, das über die Vergangenheit herausgefunden wurde, neu darstellen und mit einem gewissen zeitlichen Abstand zu dem dargestellten historischen Inhalt erstellt wurden. Das unterscheidet sie von Quellen, die aus der Zeit selbst stammen, über die wir durch sie Informationen gewinnen können. Somit sind zum Beispiel auch die Erklärtexte in deinem Schulbuch für Geschichte als Darstellungen zu bezeichnen.
-
Welche Darstellung gehört zu welcher Quelle?
TippsHistorische Darstellungen können nicht nur Texte, sondern auch Rekonstruktionen, Modelle, Bilder oder Filme sein.
LösungÜberreste von Gebäuden, wie das berühmte Kolosseum in Rom, ermöglichen die Anfertigung von Modellen und Rekonstruktionen.
Erhaltene Waffen, wie z. B. Axtklingen der Wikinger oder Schwerter der Ritter, können als Grundlage für die Darstellung von historischen Inhalten in Spielfilmen oder auch für Spielzeuge dienen.
Außerdem prägen bis heute erhaltene Büsten von historischen Persönlichkeiten wie der berühmten Pharaonin Kleopatra heutige Darstellungen, z. B. auch in Comics.
-
Beurteile die Perspektivität von Quellen.
TippsDrei der Aussagen über Quellen sind zutreffend.
Bei der Beurteilung von Quellen sollte immer auch die Perspektive des Urhebers mit bedacht werden.
LösungFalsche Aussagen:
- Eine Quelle zeigt uns die unbestrittene Wahrheit über die Vergangenheit.
- Eine Quelle ist unabhängig von der Einstellung und den Absichten ihres Erzeugers.
Eine Quelle darf nicht mit unbestrittenen Vergangenheit selbst verwechselt werden, sondern hängt immer auch von der Perspektive ihres Urhbers bzw. ihrer Urheberin ab.
-
Tradition oder Überrest?
TippsIn Memoiren schreiben Personen über ihr Leben, um es mit der Öffentlichkeit zu teilen.
Zeitzeugen können jüngere Generationen von Geschehnissen in ihrer Jugend berichten.
LösungÜberreste:
- private Briefe
- Alltagsgegenstände
- Ruinen
Traditionen:
- Denkmäler
- Memoiren
- Zeitzeugenbefragungen
9.897
sofaheld-Level
6.600
vorgefertigte
Vokabeln
8.309
Lernvideos
38.669
Übungen
33.706
Arbeitsblätter
24h
Hilfe von Lehrkräften

Inhalte für alle Fächer und Klassenstufen.
Von Expert*innen erstellt und angepasst an die Lehrpläne der Bundesländer.
Testphase jederzeit online beenden
Beliebteste Themen in Geschichte
- Alexander der Große
- Marie Antoinette
- Ermächtigungsgesetz
- Karl Der Große
- George Washington
- Katharina Die Große
- Französische Revolution
- Versailler Vertrag
- Stalin
- Hitler Geburtstag
- Wallenstein
- Martin Luther
- Vormärz
- Warschauer Pakt
- Paul Von Hindenburg
- Elizabeth Bowes-Lyon
- Weimarer Verfassung
- Watergate-Affäre
- Wiener Kongress
- Absolutismus
- Wer war Konrad Adenauer
- Vietnamkrieg
- Frauen In Der Französischen Revolution
- Gewaltenteilung
- Dolchstoßlegende
- Industrielle Revolution
- Deutscher Bund
- Blitzkrieg
- Ende 2. Weltkrieg
- Gründung Brd
- Gaius Julius Caesar
- Josef Stalin
- Oktoberrevolution
- Martin Luther King
- Mittelalterliche Stadt
- Queen Victoria
- Imperialismus
- Schwarzer Freitag
- Soziale Frage
- Was bedeutet Gleichschaltung
- Dante Alighieri
- Wannseekonferenz
- Verfassung 1871 Vorteile Nachteile
- Kapp-Putsch
- Erfindungen Industrialisierung
- Wollt Ihr Den Totalen Krieg
- Reichstagsbrand
- Hindenburg Zeppelin
- Nationalsozialismus
- NS Ideologie


 5 Minuten verstehen
5 Minuten verstehen
 5 Minuten üben
5 Minuten üben
 2 Minuten Fragen stellen
2 Minuten Fragen stellen

 Bereit für eine echte Prüfung?
Bereit für eine echte Prüfung?