Der Elektromotor
Wie funktioniert ein Elektromotor? Erfahre, wie Elektromotoren durch elektromagnetische Induktion arbeiten und elektrische Energie in mechanische Energie umwandeln. Entdecke die Bestandteile, Funktionsweise und verschiedene Arten von Elektromotoren. Interessiert? Das und vieles mehr erfährst du hier!
in nur 12 Minuten? Du willst ganz einfach ein neues
Thema lernen in nur 12 Minuten?
-
 5 Minuten verstehen
5 Minuten verstehen
Unsere Videos erklären Ihrem Kind Themen anschaulich und verständlich.
92%der Schüler*innen hilft sofatutor beim selbstständigen Lernen. -
 5 Minuten üben
5 Minuten üben
Mit Übungen und Lernspielen festigt Ihr Kind das neue Wissen spielerisch.
93%der Schüler*innen haben ihre Noten in mindestens einem Fach verbessert. -
 2 Minuten Fragen stellen
2 Minuten Fragen stellen
Hat Ihr Kind Fragen, kann es diese im Chat oder in der Fragenbox stellen.
94%der Schüler*innen hilft sofatutor beim Verstehen von Unterrichtsinhalten.

Grundlagen zum Thema Der Elektromotor
Der Elektromotor
Elektromotoren spielen in vielen Bereichen unseres Lebens eine wichtige Rolle. Sie sind in vielen Elektrogeräten wie zum Beispiel Festplatten oder Blu-Ray-Playern verbaut. Und auch bei Automobilen kommen immer häufiger Elektromotoren zum Einsatz. Aber wie funktioniert so ein Elektromotor überhaupt?
Der Elektromotor – Aufbau und Funktionsweise
Das physikalische Funktionsprinzip eines Elektromotors basiert auf der elektromagnetischen Induktion und der Umwandlung von elektrischer in mechanische Leistung – man kann einen Motor daher als Energiewandler bezeichnen. Als einfachste Umsetzung dieses Prinzips kann man sich einen Stab aus Metall vorstellen. Dieser ist von einer Spule umwickelt und befindet sich drehbar gelagert zwischen den zwei Polen eines Permanentmagneten. Fließt ein Strom durch die Spule, baut sich ein Magnetfeld in und um die Spule herum auf. Der umwickelte Metallstab kann nun also als Elektromagnet betrachtet werden. Je nach Polung stoßen sich dann die gleichnamigen Pole des Elektromagneten und des Permanentmagneten ab oder die verschiedennamigen Pole ziehen sich an. So werden Spule und Metallstab in Drehung versetzt. Allerdings endet diese Bewegung, sobald sich Spule und Metallstab entlang der Feldlinien des Permanentmagneten ausgerichtet haben – denn dann liegen sich die unterschiedlichen Pole gegenüber und die anziehenden magnetischen Kräfte halten den Stab in Position. Dieses Problem umgeht der Elektromotor durch spezielle Bauteile.

Bestandteile eines Elektromotors
Ein Elektromotor besteht aus einer beweglichen Baugruppe und einer unbeweglichen Baugruppe. Als unbewegliche Baugruppe bezeichnet man den feststehenden Magneten, also den Permanentmagneten in unserer Beschreibung. Man bezeichnet ihn manchmal auch als Stator.
Der bewegliche Teil, der insgesamt auch als Rotator (vereinfacht Rotor) bezeichnet wird, besteht aus dem Eisenkern, der auch Anker genannt wird, der Spule, die ihn umwickelt und dem Kommutator. Der Kommutator ist das entscheidende Bauelement, das verhindert, dass der Motor stehen bleibt. Er besteht aus einem Schleifring, der aus zwei Segmenten zusammengesetzt ist, die mit einer isolierenden Schicht voneinander getrennt sind. Außerdem hat er zwei Schleifkontakte, die je eines der Segmente mit den Polen einer Spannungsquelle verbinden. Dreht sich der Schleifring, liegen irgendwann die Schleifkontakte genau auf der isolierenden Schicht und keines der Segmente ist mit der Spannungsquelle verbunden. Dreht sich der Ring im Anschluss ein paar Grad weiter, sind die Segmente wieder mit der Spannungsquelle verbunden, allerdings in umgekehrter Polung.
Der Kommutator ist so mit der Spule des Rotators verbunden, dass gerade dann kein Strom durch die Spule fließt, wenn der Rotator genau entlang der Feldlinien des Stators ausgerichtet ist. Die Spule bildet demzufolge in dieser Position kein Magnetfeld aus, das den Rotator festhalten würde. Aus diesem Grund dreht sich der Rotator aufgrund seiner Trägheit weiter, bis die Spule in umgekehrter Richtung mit der Spannungsquelle verbunden ist. Dann ist das Magnetfeld der Spule gerade so gepolt, dass seine Pole gleichnamig zu denen des Stators sind und sie sich abstoßen. Der Rotator dreht sich weiter und der Elektromotor läuft.
Elektromotor – Arten
Es gibt verschiedene Arten, wie Motoren aufgebaut sein können. Der Aufbau, den wir als Beispiel beschrieben haben, ist eine der einfachsten Varianten. Moderne Elektromotoren haben beispielsweise häufig mehr als einen Anker.
Der Elektromotor in unserem Beispiel wird mit Gleichstrom betrieben. Es gibt aber auch Elektromotoren, die Wechselstrom nutzen. Bei solchen Wechselstrommotoren gibt es keinen Kommutator, der Anker ist ein Magnet mit immer gleicher Polung. Dafür besteht der Stator aus einem Elektromagneten, an dem eine Wechselspannung anliegt. So wird er ständig umgepolt und übernimmt die Aufgabe des Kommutators.
Technische Anwendungen von Elektromotoren
Elektromotoren finden in vielen verschiedenen Bereichen Anwendung. Sie werden in Eisenbahnen und Straßenbahnen, aber beispielsweise auch in Fabriken eingesetzt. Aber auch in vielen Haushaltsgeräten, Spielzeugen und Robotern finden sich Elektromotoren. In einem DVD-Spieler sind beispielsweise mehrere Elektromotoren verbaut. Mittlerweile werden sie auch vermehrt in Autos eingesetzt, um den Verbrennermotor zu ersetzen.
Übrigens können Autos mit Elektromotor einen sehr hohen Wirkungsgrad und eine hohe Leistung erreichen.
Zusammenfassung zum Elektromotor
Wir haben uns angesehen, wie ein Elektromotor funktioniert. Der Elektromotor beruht auf dem Motorprinzip und ist das Gegenstück zum Generator.

Der Aufbau des Elektromotors ermöglicht eine flüssig laufende Rotation des Motors. Beim Gleichstrommotor ist dafür ein Kommutator notwendig. Wir haben uns aber auch andere Bau- und Betriebsarten von Elektromotoren angesehen.
Transkript Der Elektromotor
„Elektromotor“ – das klingt so modern und fortschrittlich! Da denkt man an E-Autos, Drohnen und E-Scooter. Dabei sind Elektromotoren eigentlich 'ne ganz alte Platte. Schon seit über hundert Jahren gibt es sie – in elektrischen Straßenbahnen, Waschmaschinen, Nähmaschinen und ja, auch Autos. Überall funktioniert „Der Elektromotor“ nach dem gleichen Prinzip. Wie genau, das lernst du in diesem Video. Ein Elektromotor wandelt „elektrische Energie“ in „Bewegungsenergie“ um. Das nennt man das „Motorprinzip“. Es beschreibt genau den entgegengesetzten Vorgang zum „Generatorprinzip“, das beispielsweise in einem Kraftwerk verfolgt wird: Hier wird Bewegungsenergie in elektrische Energie umgewandelt. Die beiden Fälle stellen damit zwei Seiten einer Medaille dar; und in beiden spielen Magnetfelder eine entscheidende Rolle. Sehen wir uns das mal beim „Motor“ genauer an. Da gibt es den „Stator“, der im einfachsten Fall ein großer Permanentmagnet in Hufeisenform ist. Der heißt so, weil er „statisch“ ist, sich also nicht bewegt. Bewegen soll sich allerdings der „Rotor“. Das ist ein „Elektromagnet“, also eine Drahtspule mit Eisenkern, die drehbar gelagert ist. Die Bewegung soll also eine Rotation werden. Das ist ja auch nützlich, wenn sich beispielsweise die Reifen eines „E-Autos“ drehen sollen. Aber was sorgt nun dafür, dass der Rotor sich dreht? Es wird eine „Spannung“ angelegt, sodass Strom fließt und elektrische Energie zugeführt wird. Dadurch wird um den Spulendraht ein magnetisches Feld erzeugt, sodass sich im Eisenkern ein magnetischer Nord- und Südpol ausbildet. Diese werden nun von den Polen des Permanentmagneten angezogen, beziehungsweise abgestoßen – der Rotor dreht sich. Das bleibt allerdings nur ein kurzes Vergnügen, denn sobald der Eisenkern waagerecht steht, tut sich nichts mehr. Jetzt liegen sich die ungleichnamigen Pole nämlich genau gegenüber und die magnetische Anziehung hält den Rotor fest. Die Spule muss umgepolt werden, damit es weitergehen kann. Das erledigt der „Kommutator“, oder auch „Polwender“. Das ist ein kleiner, zweigeteilter Zylinder, der an der Drehachse der Spule sitzt – und zwar dort, wo diese mit der Stromzufuhr verbunden ist. Die beiden Zylinderhälften sind elektrisch isoliert voneinander. Während sich die Spule dreht, bleibt eine Hälfte über einen sogenannten „Schleifkontakt“ mit dem Plus-Pol der Stromquelle in Verbindung, während die andere mit dem Minus-Pol verbunden ist. Entsprechend der „Stromrichtung“ im Spulendraht bilden sich im Eisenkern die magnetischen Pole „Nord“ und „Süd“. Erreicht der Rotor nun die Gleichgewichtslage im Magnetfeld des Permanentmagneten, den sogenannten „Totpunkt“, fließt kein Strom mehr und das Magnetfeld der Spule verschwindet. Das wird allerdings nur kurz der Fall sein, denn durch die Trägheit des Eisenkerns steht der Rotor nicht sofort still, sondern schwingt ein kleines Stück weiter. Wie du siehst, müssen jetzt die Zylinderhälften des Kommutators ihre Vorzeichen tauschen, denn die Stromzufuhr steht nun mit der jeweils anderen Hälfte in Verbindung. Mit der Ladung des Kommutators ändern sich auch die Pole des neu aufgebauten Magnetfeldes, da der Strom in der Spule seine Richtung geändert hat. Nun stehen sich Gleichnamige Pole von Stator und Rotor gegenüber. Diese stoßen sich nun ab und die Rotation setzt sich fort. Bei jedem Durchlaufen des Totpunkts wird nun das Magnetfeld des Rotors durch den Kommutator umgepolt, und die Rotation läuft flüssig weiter. Es gibt aber einen Nachteil: Wenn der Rotor im Totpunkt stehen bleibt oder abgestellt wird, muss er erst von außen angestoßen werden, bevor die Bewegung elektrisch fortgesetzt werden kann. Dieses Problem kann aber umgangen werden: Der Aufbau des Rotors kann so verändert werden, dass es gar keine eindeutige Gleichgewichtslage gibt – und damit keinen Totpunkt. Als Alternative zum „Doppel-T-Anker“, wie der einfache Rotor auch genannt wird, wäre zum Beispiel ein „Dreifachanker“ eine Möglichkeit, bei dem sich die Pole nie symmetrisch gegenüberliegen. Treibt man das Spiel mit mehreren Segmenten weiter, landet man beim „Trommelanker“. Außerdem kann der Elektromotor statt mit Gleichstrom auch mit Wechselstrom betrieben werden. So wird das Magnetfeld der Spule ganz ohne Kommutator automatisch umgepolt, der Frequenz der Wechselspannung folgend. In einer weiteren Variante kann auch vollständig auf Permanentmagnete verzichtet werden. Stattdessen können Elektro-Magnete als Stator verwendet werden. Diese können dann mit der Spannungsquelle der Rotor-Spule verbunden werden, wenn ein Kommutator genutzt wird. So ist es ganz egal, ob der Motor mit Gleichspannung betrieben wird, wobei der „Rotor“ umgepolt wird, oder eine Wechselspannung anliegt, die hier den „Stator“ umpolt. Das nennt man „Allstrommotor“. Alle Arten von Elektromotoren haben den Vorteil, dass die Energieumwandlung sehr effizient stattfindet. Bis zu neunzig Prozent der zugeführten Energie wird in „Bewegungsenergie“ umgewandelt. Bei Verbrennungsmotoren sind es allerhöchstens fünfzig Prozent – der Rest wird als wärme abgegeben. Aber der Strom muss natürlich auch erstmal verfügbar sein! Was denkst du, wann wird wohl die Mehrzahl der Autos mit Elektromotoren fahren? Schreib es in die Kommentare! Vorher fassen wir noch kurz zusammen: Der „Elektromotor“ ist das Gegenstück zum Generator: Er wandelt elektrische Energie in Bewegungsenergie um. Das Motorprinzip basiert auf einem Elektromagneten, der sich als Rotor im Magnetfeld eines festen Stators drehen kann. Es gibt Gleichstrommotoren mit Kommutator, Wechselstrommotoren, und Allstrommotoren. Elektromotoren sind sehr „energieeffizient“. Also wenn erst mal genügend Strom aus erneuerbaren Energien zur Verfügung steht, werden sich solche Stinker wohl gar nicht mehr lohnen.
Der Elektromotor Übung
-
Vervollständige die Abbildung zu dem Prinzip eines Generators bzw. eines Motors.
TippsDas Motorprinzip beschreibt, wie ein Elektromotor funktioniert: Ein Elektromotor wandelt elektrische Energie in Bewegungsenergie um.
Das Generatorprinzip beschreibt den umgekehrten Vorgang zum Motoprinzip.
Das Generatorprinzip beschreibt also die Umwandlung von Bewegungsenergie in elektrische Energie.
LösungMotorprinzip
Das Motorprinzip beschreibt, wie ein Elektromotor funktioniert: Ein Elektromotor wandelt elektrische Energie in Bewegungsenergie um. Dies geschieht durch die Interaktion zwischen dem statischen Stator und dem sich drehenden Rotor. Der Stator ist ein fester Permanentmagnet, während der Rotor ein Elektromagnet mit einem Eisenkern ist. Wenn eine Spannung angelegt wird und Strom fließt, dann entsteht ein magnetisches Feld in der Spule des Rotors, was zu Nord- und Südpolen im Eisenkern führt. Diese Pole interagieren mit den Polen des Permanentmagneten im Stator und erzeugen Anziehung oder Abstoßung, was den Rotor in Bewegung versetzt. Um eine kontinuierliche Rotation aufrechtzuerhalten, wird der Kommutator genutzt. Dieser ändert die Stromrichtung in der Rotorspule, wenn der Rotor den Totpunkt erreicht. Dadurch ändern sich die magnetischen Pole im Rotor und die Rotation setzt sich fort.
Generatorprinzip
Das Generatorprinzip beschreibt den umgekehrten Vorgang: die Umwandlung von Bewegungsenergie in elektrische Energie. In einem Generator wird ein sich bewegender Leiter (der Rotor) durch ein Magnetfeld (der Stator) geführt. Dadurch wird eine Spannung in dem Leiter induziert, die als elektrische Energie abgegriffen werden kann. Die Bewegung des Leiters relativ zum Magnetfeld führt zur Erzeugung von Wechselstrom. Der Kommutator, der im Elektromotor verwendet wird, ist hier nicht notwendig, da die Erzeugung von Wechselstrom automatisch durch die Bewegung des Rotors im Magnetfeld erfolgt.
-
Beschreibe die Funktion eines Elektromotors.
TippsEin Elektromotor besteht aus einem einem Rotor, einem Stator und einem Kommutator.
Der Stator ist ein statischer Permanentmagnet und der Rotor ist eine Spule mit Eisenkern.
Eine Spannung wird angelegt, um eine Rotation zu ermöglichen.
Ein Kommutator ist ein zweigeteilter Zylinder, der die Stromrichtung ändert.
LösungDer Elektromotor besteht aus einem Stator, einem Rotor und einem Kommutator. Der Stator ist ein statischer Permanentmagnet in Hufeisenform, während der Rotor eine drehbare Spule mit Eisenkern ist. Die Rotation des Rotors erzeugt Bewegung, ähnlich wie sich die Reifen eines Elektroautos drehen.
Um die Rotation zu ermöglichen, wird eine Spannung angelegt, die einen Stromfluss und somit ein magnetisches Feld um die Spule erzeugt. Im Eisenkern des Rotors bilden sich Nord- und Südpole aus, die von den Polen des Permanentmagneten angezogen oder abgestoßen werden, wodurch der Rotor sich dreht. Allerdings wird der Rotor aufgrund der magnetischen Anziehung im Gleichgewichtszustand festgehalten. Hier kommt der Kommutator ins Spiel: ein zweigeteilter Zylinder, der die Stromrichtung ändert, wenn der Rotor den Totpunkt erreicht. Dadurch ändern sich die Pole im Magnetfeld des Rotors, wodurch sich Stator und Rotor abstoßen und die Rotation fortsetzen.
Es gibt verschiedene Arten von Elektromotoren: Gleichstrommotoren verwenden einen Kommutator, um die Stromrichtung zu ändern. Wechselstrommotoren verwenden eine Wechselspannung, um das Magnetfeld der Spule automatisch umzupolen. Allstrommotoren können sowohl mit Gleichspannung als auch mit Wechselspannung betrieben werden, indem Elektromagnete als Stator verwendet werden.
-
Beschreibe die Bestandteile eines Elektromotors.
TippsDer Stator ist der feste Teil des Elektromotors, der das Magnetfeld bereitstellt, in dem sich der Rotor bewegt.
Der Rotor ist der sich drehende Teil des Elektromotors und wird durch die Interaktion mit dem Magnetfeld des Stators angetrieben.
Der Kommutator ist dafür verantwortlich, die Stromrichtung in der Rotorspule zu ändern, wenn der Rotor den Totpunkt erreicht, um die Rotation aufrechtzuerhalten.
Der Permanentmagnet im Stator erzeugt das Magnetfeld, das den Rotor antreibt.
LösungDie meisten Elektromotoren bestehen aus einem Stator, einem Rotor und einem Kommutator:
Der Stator erzeugt das statische Magnetfeld und bleibt in Ruhe.
Der Rotor ist eine Spule mit einem Eisenkern, welche sich drehen kann und die Bewegung im Elektromotor verursacht.
Der Kommutator ist dafür verantwortlich, die Stromrichtung der Spule zu ändern, um die kontinuierliche Drehung des Rotors aufrechtzuerhalten.
Der Permanentmagnet ist ein großer Magnet in Hufeisenform, der Teil des Stators ist und das Magnetfeld erzeugt.
Durch die Zuordnung der Bestandteile zu den entsprechenden Beschreibungen wird deutlich, wie jeder Teil des Elektromotors eine wichtige Rolle bei der Umwandlung von elektrischer Energie in Bewegungsenergie spielt: Der Stator erzeugt das Magnetfeld, der Rotor wird durch die Wechselwirkung mit diesem Magnetfeld in Bewegung versetzt, der Kommutator ändert die Stromrichtung für die kontinuierliche Rotation und der Permanentmagnet sorgt für das statische Magnetfeld im Stator.
-
Benenne Vorteile und Nachteile von Elektromotoren.
TippsElektrizität ist in der Regel preiswerter als Benzin oder Diesel.
Elektromotoren erzeugen keine Abgase.
Elektromotoren sind im Betrieb leise.
Durch den Mangel an Abgasen tragen Elektrofahrzeuge zur Verbesserung der Luftqualität bei.
Das Aufladen der Batterien von Elektrofahrzeugen dauert im Vergleich zum Betanken eines Verbrennungsfahrzeugs länger.
LösungVorteile von Elektromotoren gegenüber Verbrennungsmotoren:
- kostengünstiges „Tanken“: Ein großer Vorteil von Elektromotoren ist die geringe Kostenbelastung für den Treibstoff. Denn Elektrizität ist in der Regel preiswerter als Benzin oder Diesel, was zu niedrigeren Betriebskosten führt.
- umweltfreundlich: Elektromotoren erzeugen keine Abgase, was eine erhebliche Reduzierung von Luftschadstoffen und Treibhausgasemissionen bedeutet. Dies ist insbesondere in Zeiten zunehmender Umweltbedenken von großer Wichtigkeit.
- geräuscharm: Elektromotoren sind im Betrieb leise, was eine angenehme Fahrerfahrung und eine geringere Lärmbelastung in städtischen Gebieten zur Folge hat.
- kaum Emissionen: Durch den Mangel an Abgasen tragen Elektrofahrzeuge zur Verbesserung der Luftqualität bei, was insbesondere in stark befahrenen Innenstädten von Vorteil ist.
Nachteile von Elektromotoren im Vergleich zu Verbrennungsmotoren:
- hohe Anschaffungskosten: Elektrofahrzeuge sind in der Regel teurer in der Anschaffung als vergleichbare Verbrennungsfahrzeuge. Dies liegt hauptsächlich an den Kosten für die Batterietechnologie.
- geringe Lebensdauer der Batterie: Die Batterien in Elektrofahrzeugen haben eine begrenzte Lebensdauer, nach der sie ersetzt werden müssen. Der Austausch einer Batterie kann teuer sein und beeinflusst die Gesamtbetriebskosten.
- geringe Kilometerreichweite: Obwohl sich die Technologie verbessert hat, haben viele Elektrofahrzeuge immer noch eine begrenzte Kilometerreichweite pro Ladung im Vergleich zu den Reichweiten von Verbrennungsfahrzeugen.
- lange Ladezeiten: Das Aufladen der Batterien von Elektrofahrzeugen dauert im Vergleich zum Betanken eines Verbrennungsfahrzeugs länger. Schnellladestationen sind zudem noch nicht flächendeckend verfügbar.
-
Benenne die Hauptfunktion des Elektromotors.
TippsEin Elektromotor erzeugt zwar ein magnetisches Feld, doch seine Hauptfunktion ist nicht die Erzeugung von magnetischer Energie aus elektrischer Energie.
Ein Elektromotor erzeugt sicherlich Wärme, insbesondere aufgrund des Stromflusses durch die Drahtspule. Aber die Hauptfunktion eines Elektromotors besteht nicht darin, elektrische Energie in Wärmeenergie umzuwandeln.
Ein Elektromotor erzeugt nicht selbst elektrische Energie aus Bewegungsenergie.
LösungEin Elektromotor besteht aus einem Stator (feststehender Teil) und einem Rotor (sich drehender Teil). Der Stator kann als großer Permanentmagnet betrachtet werden, während der Rotor eine Drahtspule mit einem Eisenkern ist. Wenn eine Spannung angelegt wird, dann fließt Strom durch die Drahtspule im Rotor, was ein magnetisches Feld erzeugt. Dieses Feld interagiert mit dem Magnetfeld des Stators, was dazu führt, dass der Rotor sich dreht. Dies ist der Schlüsselprozess, durch den elektrische Energie in Bewegungsenergie umgewandelt wird.
- Er wandelt elektrische Energie in Bewegungsenergie um.
- Er erzeugt elektrische Energie aus Bewegungsenergie.
- Er erzeugt magnetische Energie aus elektrischer Energie.
- Er erzeugt Wärmeenergie aus elektrischer Energie.
-
Nimm Stellung zu der folgenden Aussage.
TippsDer Wirkungsgrad hängt nicht ausschließlich von der mechanischen Reibung ab.
Der Wirkungsgrad hängt nicht nur von der Art des Motors ab, sondern auch von anderen Faktoren wie dem Design des Motors.
Die Effizienz eines Motors hat durchaus Einfluss auf die Entscheidung, Elektroautos zu verwenden.
LösungUm die korrekte Antwort zu finden, müssen wir das Konzept des Wirkungsgrades sowie die Funktionsweise von Elektromotoren und Verbrennungsmotoren berücksichtigen:
Der Wirkungsgrad misst das Verhältnis der nutzbaren Ausgangsleistung zur zugeführten Eingangsleistung: Ein höherer Wirkungsgrad bedeutet, dass mehr Energie in die gewünschte Form umgewandelt wird und weniger Energie als ungenutzte oder verlorene Energie verschwendet wird.- Leyla: „Elektromotoren haben eine höhere Effizienz, da sie Energie direkt in Bewegung umwandeln, während Verbrennungsmotoren einen Teil der Energie durch Wärme verlieren.“
- Tom: „Der Wirkungsgrad eines Elektromotors ist höher, weil er weniger mechanische Reibung hat als ein Verbrennungsmotor.“
- Sophie: „Der Wirkungsgrad hängt nur von der Art des Motors ab und nicht von der Energiequelle, die sie verwenden.“
- Max: „Die Effizienz eines Motors hat keinen Einfluss auf die Entscheidung, Elektroautos zu verwenden.“
9.919
sofaheld-Level
6.600
vorgefertigte
Vokabeln
8.312
Lernvideos
38.646
Übungen
33.706
Arbeitsblätter
24h
Hilfe von Lehrkräften

Inhalte für alle Fächer und Klassenstufen.
Von Expert*innen erstellt und angepasst an die Lehrpläne der Bundesländer.
Testphase jederzeit online beenden
Beliebteste Themen in Physik
- Temperatur
- Schallgeschwindigkeit
- Dichte
- Drehmoment
- Transistor
- Lichtgeschwindigkeit
- Elektrische Schaltungen – Übungen
- Galileo Galilei
- Rollen- Und Flaschenzüge Physik
- Radioaktivität
- Aufgaben zur Durchschnittsgeschwindigkeit
- Lorentzkraft
- Beschleunigung
- Gravitation
- Ebbe und Flut
- Hookesches Gesetz Und Federkraft
- Elektrische Stromstärke
- Elektrischer Strom Wirkung
- Reihenschaltung
- Ohmsches Gesetz
- Freier Fall
- Kernkraftwerk
- Reflexionsgesetz: Ebener Spiegel – Übungen
- Was sind Atome
- Aggregatzustände
- Infrarot, Uv-Strahlung, Infrarot Uv Unterschied
- Isotope, Nuklide, Kernkräfte
- Transformator
- Lichtjahr
- Si-Einheiten
- Fata Morgana
- Gammastrahlung, Alphastrahlung, Betastrahlung
- Kohärenz Physik
- Mechanische Arbeit
- Schall
- Elektrische Leistung
- Dichte Luft
- Ottomotor Aufbau
- Kernfusion
- Trägheitsmoment
- Heliozentrisches Weltbild
- Energieerhaltungssatz Fadenpendel
- Linsen Physik
- Ortsfaktor
- Interferenz
- Diode und Photodiode
- Wärmeströmung (Konvektion)
- Schwarzes Loch
- Frequenz Wellenlänge
- Elektrische Energie




 5 Minuten verstehen
5 Minuten verstehen
 5 Minuten üben
5 Minuten üben
 2 Minuten Fragen stellen
2 Minuten Fragen stellen

 Bereit für eine echte Prüfung?
Bereit für eine echte Prüfung?










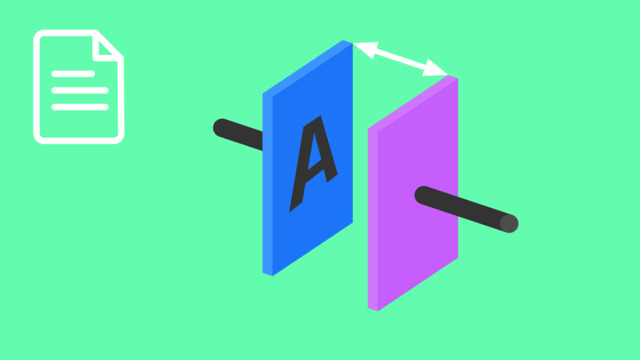









0 autos mit strom
hat mir sehr geholfen!
hat mir echt gut geholfen
Richtig gut