Zinn
Erfahre alles Wissenswerte über das chemische Element Zinn. Zinn ist ein seltenes und wertvolles Metall mit wichtigen Anwendungen im technischen Bereich. Lerne mehr über die Eigenschaften, das Vorkommen und die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten von Zinn, einschließlich seiner Verwendung in der Elektronikindustrie und der Herstellung von Zinnlegierungen wie Bronze.


in nur 12 Minuten? Du willst ganz einfach ein neues
Thema lernen in nur 12 Minuten?
-
 5 Minuten verstehen
5 Minuten verstehen
Unsere Videos erklären Ihrem Kind Themen anschaulich und verständlich.
92%der Schüler*innen hilft sofatutor beim selbstständigen Lernen. -
 5 Minuten üben
5 Minuten üben
Mit Übungen und Lernspielen festigt Ihr Kind das neue Wissen spielerisch.
93%der Schüler*innen haben ihre Noten in mindestens einem Fach verbessert. -
 2 Minuten Fragen stellen
2 Minuten Fragen stellen
Hat Ihr Kind Fragen, kann es diese im Chat oder in der Fragenbox stellen.
94%der Schüler*innen hilft sofatutor beim Verstehen von Unterrichtsinhalten.

Grundlagen zum Thema Zinn
Zinn – Definition
In diesem Text geht es um das chemische Element Zinn. Es wird mit dem Elementsymbol $\ce{Sn}$ abgekürzt.
Zinn $\left( \ce{Sn} \right)$ gehört zu den Metallen und hat die Ordnungszahl $50$ – ein Zinnatom hat also $50$ Elektronen und $50$ Protonen. Es befindet sich im Periodensystem der Elemente (PSE) in der IV. Hauptgruppe und hat demzufolge vier Außenelektronen, genau wie seine Hauptgruppennachbarn Kohlenstoff $\left( \ce{C} \right)$, Silicium $\left( \ce{Si} \right)$, Germanium $\left( \ce{Ge} \right)$ und Blei $\left( \ce{Pb} \right)$.
Das chemische Symbol $\ce{Sn}$ bezieht sich auf das lateinischen Wort stannum für Zinn. Die Wertigkeit – auch Oxidationszahl genannt – beträgt entsprechend der Hauptgruppennummer maximal $\ce{+IV}$, je nach Verbindung auch manchmal $\ce{+II}$. So verbindet sich Zinn mit Sauerstoff, der (fast) immer die Wertigkeit $\ce{-II}$ hat, meist zu Zinn(IV)‑oxid, $\overset{\text{+IV -II }}{\ce{SnO2}}$. Es kann aber auch Zinn(II)‑oxid bilden, $\overset{\text{+II -II }}{\ce{SnO}}$. In dieser Verbindung ist das Zinn zweiwertig. In Zinn(II,IV)‑oxid kommen sowohl $\overset{\text{+II~}}{\ce{Sn}}$ als auch $\overset{\text{+IV~}}{\ce{Sn}}$ vor.
Wusstest du schon?
Zinn war eines der ersten Metalle, das von Menschen verarbeitet wurde! Bereits im alten Ägypten, vor etwa $4\,500$ Jahren, wurde Zinn mit Kupfer gemischt, um eine Legierung zu erhalten – nämlich Bronze.
Die daraus hergestellten Bronzezeit‑Werkzeuge und Waffen waren viel beständiger und stärker als reine Kupferprodukte. Ohne Zinn wären viele Errungenschaften der antiken Welt nicht möglich gewesen!
Zinn – Steckbrief
Die wichtigsten physikalischen Eigenschaften von elementarem Zinn lassen sich wie folgt zusammenfassen:
| Steckbrief Zinn | |
|---|---|
| Elementsymbol | $\ce{Sn}$ |
| Ordnungszahl | $50$ |
| Atommasse | $65{,}380 \, \frac{\text{g}}{\text{mol}}$ |
| Dichte $\rho$ | $7{,}265 \, \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ |
| Schmelzpunkt (Smp.) | $231{,}9\,\pu{°C}~~$ (unter Normaldruck) |
| Siedepunkt (Sdp.) | $2\,620\,\pu{°C}~~$ (unter Normaldruck) |
| Elektrische Leitfähigkeit $\sigma$ | $8{,}69 \cdot {10}^{6} \, \frac{\text{A}}{\text{Vm}}$ |
| Oxidationsstufen | $\text{+II}$ oder $\text{+IV}~~$ (in den meisten Fällen) |
| Härte | sehr weich, Wert zwischen $1$ und $2$ auf der Mohshärte-Skala |
| Aussehen | silbrig metallisch glänzend |
Zinn zählt aufgrund seiner relativ hohen Dichte zu den Schwermetallen, wobei es für ein Metall einen sehr niedrigen Schmelzpunkt hat (ähnlich wie Blei). Bei Raumtemperatur ist das Metall so weich, dass es sich mit dem Fingernagel einritzen lässt.
Achtung: Diese Eigenschaften gelten für das sogenannte $\beta$‑Zinn. Weiter unten im Text sehen wir uns an, was es damit auf sich hat.
Eigenschaften von Zinn
Zusätzlich zu den im Steckbrief aufgelisteten Eigenschaften wollen wir nun auch auf wichtige chemische Eigenschaften des Zinns eingehen:
- Zinn reagiert nicht mit Wasser $\left( \ce{H2O} \right)$.
- Es bildet eine feste Oxidschicht auf seiner Oberfläche, die vor Korrosion schützt.
- Zinn ist ein Amphoter, das heißt, es reagiert sowohl als Säure als auch als Base.
Elementares Zinn kann in drei verschiedenen Modifikationen vorliegen:
Kennst du das?
Vielleicht hast du schon einmal ein selbstgemachtes Zinnarmband getragen oder gesehen, wie jemand Zinnschmuck herstellt. Zinn ist ein Metall, das oft für Schmuck verwendet wird, weil es leicht zu formen und widerstandsfähig gegen Korrosion ist.
Wenn du lernst, wie Zinn bearbeitet wird, verstehst du auch die chemischen Reaktionen, die es so beständig machen. So wird Chemie ganz praktisch und sogar tragbar!
Zinn in chemischen Verbindungen
Zinn kann mit Sauerstoff zu Zinn(IV)‑oxid $\left( \ce{SnO2} \right)$ oder Zinn(II)‑oxid $\left( \ce{SnO} \right)$ reagieren. Auch eine Mischung der beiden Oxide, Zinn(II,IV)‑oxid, ist möglich. Zinn(IV)‑oxid ist der Hauptbestandteil des Minerals Kassiterit, in dem Zinn in der Natur am häufigsten vorkommt. Es entsteht außerdem bei der Verbrennung von reinem Zinnpulver an Luftsauerstoff bei $1\,500\,^\circ\text{C}$:
$\ce{Sn + O2-> SnO2}$
Zinn(IV)‑oxid lässt sich mithilfe von Kohlenstoff $\left( \ce{C} \right)$ wieder zu elementarem Zinn reduzieren. Dabei entsteht letztendlich auch Kohlenstoffdioxid $\left( \ce{CO2} \right)$:
$\begin{array}{lclclcl} \ce{SnO2} & + & \ce{2C} & \longrightarrow & \ce{Sn} & + & \ce{2CO} \\[4pt] \ce{SnO2} & + & \ce{2CO} & \longrightarrow & \ce{Sn} & + & \ce{2CO2} \end{array}$
Weitere wichtige Zinnverbindungen sind die Salze Zinn(IV)‑chlorid $\left( \ce{SnCl4} \right)$ und Zinn(II)‑chlorid $\left( \ce{SnCl2} \right)$, sowie Zinn(IV)‑sulfat $\left( \ce{Sn(SO4)2} \right)$ und Zinn(II)‑sulfat $\left( \ce{SnSO4} \right)$.
Wenn Zinn mit konzentrierter Salzsäure $\left( \ce{HCl} \right)$ reagiert, entsteht außerdem Wasserstoff $\left( \ce{H2} \right)$:
$\ce{Sn + 2HCl -> SnCl2 + H2}$
Zinn(II)‑sulfat $\left( \ce{SnSO4} \right)$ kann durch die Reaktion von Zinn(II)‑oxid $\left( \ce{SnO} \right)$ mit Schwefelsäure $\left( \ce{H2SO4} \right)$ gebildet werden, wobei außerdem Wasser $\left( \ce{H2O} \right)$ entsteht:
$\ce{SnO + H2SO4 -> SnSO4 + H2O}$
Ein etwas komplexeres, für Anwendungen in der Färberei wichtiges, Zinnsalz ist Ammoniumhexachlorostannat(IV), sogenanntes Pinksalz $\left( \ce{(NH4)2[SnCl6]} \right)$. In der Wortendung
Die Verbindung Zinn(IV)‑sulfid $\left( \ce{SnS2} \right)$ wird beim sogenannten Bronzieren als Farbpigment eingesetzt. Es ist für einen goldenen Farbton verantwortlich und wird auch Musivgold genannt.
Mit Bronze ist üblicherweise eine Legierung aus den Metallen Kupfer $\left( \ce{Cu} \right)$ und Zinn $\left( \ce{Sn} \right)$ gemeint, wobei noch weitere Elemente zugesetzt werden können. Genauer gesagt handelt es sich dabei um Zinnbronzen (Bronze ist der Oberbegriff für Kupferlegierungen im Allgemeinen). Solche Legierungen sind streng genommen keine chemischen Verbindungen, sondern Stoffgemische.
Daneben spielt Zinn auch in organischen Verbindungen eine Rolle. Sogenannte zinnorganische Verbindungen sind in der Regel Komplexverbindungen.
Hast du dir das Wichtigste gemerkt?
Struktur von Zinn
Zinn ist ein Metall, die einzelnen Zinnatome im Reinstoff sind also durch eine Metallbindung gebunden. Wie fast alle Metalle liegt Zinn unter Normalbedingungen als Feststoff in kristalliner Form vor. Dabei ist der Stoff in der Regel aus mehreren winzigen Kristallen zusammengesetzt. Man nennt das polykristallin. Innerhalb der kleinen Kristalle sitzen die Zinnatome auf festen Plätzen einer definierten Gitterstruktur, wobei sich die räumliche Ausrichtung der Gitterstruktur von Kristall zu Kristall unterscheiden kann.
Eine Besonderheit von Zinn ist, dass dabei drei verschiedene Gitterstrukturen möglich sind. Diese werden
| Reines, elementares Zinn |
|---|
 |
Modifikationen von Zinn
Zinn als reines Element kann in drei verschiedenen Strukturen kristallisieren. Diese nennt man auch die Modifikationen des Zinns. Die verschiedenen Modifikationen sind bei unterschiedlichen Temperatur- und Druckbedingungen stabil und können sich ineinander umwandeln. Sie unterscheiden sich deutlich in ihren Eigenschaften, wie du in folgender Tabelle sehen kannst:
| $\alpha\text{-Zinn}$ | $\beta\text{-Zinn}$ | $\gamma\text{-Zinn}$ | |
|---|---|---|---|
| Kristallstruktur | kubisches Diamantgitter | tetragonal | orthorhombisch |
| Farbe | grau | silbrig glänzend | grau |
| Dichte | $\pu{5,8 g//cm3}$ | $\pu{7,3 g//cm3}$ | $\pu{6,5 g//cm3}$ |
| Magnetische Eigenschaften | diamagnetisch | paramagnetisch | paramagnetisch |
| Stabilität | unterhalb $\pu{13,2 °C}$ | $\pu{13,2 - 162 °C}$ | oberhalb $\pu{162 °C}$ bzw. bei hohem Druck |
Die geläufigste Modifikation bei Raumbedingungen (Normaldruck und $\pu{25 °C}$) ist das metallisch glänzende $\beta$‑Zinn.
Weiter oben haben wir bereits festgehalten, dass Zinn sehr weich ist und sich demzufolge leicht verformen lässt. Dabei ist ein charakteristisches knirschendes Geräusch zu hören, das sogenannte Zinngeschrei. Dieses Geräusch entsteht, wenn die winzigen
Die Umwandlung von $\beta$‑Zinn zu $\alpha$‑Zinn bei kalten Temperaturen ist ein zweites wichtiges Phänomen, das auch unter dem Namen Zinnpest bekannt ist. Dies ist problematisch, da $\alpha$‑Zinn sehr instabil ist und als Pulver zerbröselt. Das bedeutet, dass Gegenstände aus reinem Zinn bei tieferen Temperaturen buchstäblich zerfallen, wenn sich $\beta$‑Zinn zu $\alpha$‑Zinn umwandelt. Entgegenwirken kann man diesem Problem, indem man das Zinn mit geringen Anteilen von Bismut $\left( \ce{Bi} \right)$ oder Antimon $\left( \ce{Sb} \right)$ legiert.
Vorkommen von Zinn
Zinn ist ein relativ seltenes Metall. Sein Anteil in der Erdkruste beträgt nur rund $2{,}3\,\text{ppm}$ (parts per million). In der Natur gibt es nur sehr wenige Zinnerze, also Verbindungen, in denen Zinn in größeren Mengen vorkommt. Die wichtigsten sind Kassiterit $\left( \ce{SnO2} \right)$, auch Zinnstein genannt, und Stannit $\left( \ce{Cu2FeSnS4} \right)$. Die größten Lagerstätten findet man in Südamerika (v. a. in Bolivien und Peru) und im asiatischen Raum (v. a. in China, Indonesien und Malaysia), aber auch in Deutschland gibt es Vorkommen, z. B. im sächsischen Erzgebirge. Dort wurde Zinn historisch bereits vom 15. bis ins 20. Jahrhundert abgebaut. Ob eine erneute Öffnung des Zinnbergbaus in dieser Region ökonomisch und ökologisch sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab und wird aktuell diskutiert und geprüft. Weltweit beträgt die derzeitige Förderung von Zinn etwa $350\,000\,\text{t}$ im Jahr.
Gewinnung von Zinn
Gewonnen wird Zinn aus dem Erz Kassiterit durch Zerkleinerung und anschließende Reduktion des Oxids nach folgendem Schema:
$\begin{array}{lclclcl} \text{Kassiterit} & + & \text{Kohlenstoff} & \longrightarrow & \text{Zinn} & + & \text{Kohlenstoffdioxid} \\[4pt] \ce{SnO2} & + & \ce{C} & \longrightarrow & \ce{Sn} & + & \ce{CO2} \end{array}$
Etwas genauer betrachtet handelt es sich dabei um einen zweistufigen Prozess:
$\begin{array}{lclclcl} \ce{SnO2} & + & \ce{2C} & \longrightarrow & \ce{Sn} & + & \ce{2CO} \\[4pt] \ce{SnO2} & + & \ce{2CO} & \longrightarrow & \ce{Sn} & + & \ce{2CO2} \end{array}$
Das Zinn kann dann relativ leicht durch Schmelzen abgetrennt werden. So lässt sich Rohzinn mit einer Reinheit von $97\text{–}99\,\%$ gewinnen.
Zinnerze wie Kassiterit werden als Konfliktminerale eingestuft, da der Abbau in vielen Ländern unter kritischen Bedingungen erfolgt. Außerdem werden die Reserven an Zinn bei steigendem Bedarf immer knapper. In Zukunft sollte daher das Recycling von Zinn weiter in den Vordergrund treten. Bereits heute wird mehr als ein Drittel des gesamten Zinnbedarfs über das Recycling von Altmetall gedeckt.
Nachweis von Zinn
Ein sehr zuverlässiger Nachweis von Zinn ist die sogenannte Leuchtprobe. Dabei wird zunächst aus der Reaktion von Zink $\left( \ce{Zn} \right)$ mit Salzsäure $\left( \ce{HCl} \right)$ naszierender, also sehr reaktiver, Wasserstoff erzeugt. Dieser reagiert dann mit der zu untersuchenden Probe (wenn diese Zinn enthält) zu Zinnhydrid, sogenanntem Stannan $\left( \ce{SnH4} \right)$. Erhitzt man das Gemisch im Anschluss, zeigt sich eine typische blaue Färbung, die auf Lumineszenz zurückzuführen ist.
Achtung: Diese Blaufärbung ist sehr charakteristisch für Zinn, sie tritt jedoch in ähnlicher Form auch bei Vorhandensein von Arsen oder Niob in der Probe auf.
Verwendung von Zinn
Die Verwendung von Zinn hat sich über die Zeit sehr gewandelt. Bereits im Altertum war das Element bekannt und wurde vor allem als Teil einer Legierung mit Kupfer $\left(\ce{Cu} \right)$ verwendet. Bei einer Legierung handelt es sich um ein Stoffgemisch, genauer gesagt ein Gemenge aus mindestens zwei verschiedenen Elementen, von denen mindestens eines ein Metall sein muss, sodass der entstehende Stoff eine metallische Bindung aufweist.
Eine Legierung aus Zinn $\left( \ce{Sn} \right)$ und Kupfer $\left(\ce{Cu} \right)$ wird Bronze genannt, genauer gesagt Zinnbronze. Die Entdeckung und Herstellung von Bronze war so prägend für die Menschheit, dass die Zeitspanne von $2200\text{–}800\,\text{v. u. Z.}$ (in Europa) nach ihr benannt wurde: die Bronzezeit. Auch aus der Antike sind zahlreiche Funde aus Bronze, z. B. Skulpturen, Schmuck und Geschirr (Letzteres zum Teil auch aus purem Zinn) bis heute erhalten.
| Persische Wasserkanne (Ābtābe) aus Zinnbronze |
|---|
 |
Obwohl Zinnbronzen in der heutigen Industrie keine große Rolle mehr spielen, sind viele historische Gegenstände wie die dargestellte persische Wasserkanne (aus dem 19. Jahrhundert) wertvolle Kulturzeugnisse, die von großem Erfindungsreichtum und Kunstfertigkeit zeugen.
Beginnend mit der Industrialisierung wurde dann zunehmend auch reines Zinn in technischen Bereichen verwendet, beispielsweise für Elektronikbauteile. In einigen Glasherstellungsprozessen (z. B. beim Floatglasverfahren) schwimmt die Glasschmelze auf einer Zinnschmelze, bis das Glas abgekühlt, also fest wird. Dadurch können sehr glatte Oberflächen erzeugt werden. Zinn wird außerdem für Farbpigmente, Poliermittel, verschiedene Chemikalien und in LCD‑Displays benötigt. Zinn findet weiterhin in Legierungen mit anderen Elementen eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten:
- als Lötzinn zum Verbinden von elektronischen Bauteilen (in Legierung mit Kupfer und Blei oder auch Silber)
- als Weißblech für Konservendosen (verzinntes Eisenblech)
- in der Glockengießerei, z. B. als Algerisches Metall (etwa $95\,\%$ Zinn in Legierung mit Kupfer, Antimon, Bismut)
- zur Herstellung von Münzgeld, z. B. als Nordisches Gold für die goldfarbenen Euromünzen (Legierung hauptsächlich aus $89\,\%$ Kupfer mit Aluminium, Zink und $1\,\%$ Zinn)
- als Orgelmetall, also Material für Orgelpfeifen (in Legierung mit Blei)
Schlaue Idee
Wusstest du, dass Zinn in Lötzinn enthalten ist? Beim Reparieren von elektrischen Geräten kannst du beobachten, wie Zinn als Verbindungsmaterial in der Elektronik eingesetzt wird – denn es schmilzt relativ leicht und stellt sichere Verbindungen her.
Eine kleine Geschichte des Zinns
Der standhafte Zinnsoldat ist ein Märchen von Hans Christian Andersen über eine kleine Zinnfigur. Da Zinn ein sehr weiches Metall und leicht zu bearbeiten ist, wurde es früher sehr häufig für Schmuck und Zierfiguren, aber auch Geschirr und Besteck verwendet. Heute gilt es als seltenes und wertvolles Metall mit wichtigen Anwendungen im technischen Bereich.
Aus Zinnfolie, sogenanntem Stanniol, wurde auch Lametta gefertigt. Heute wird stattdessen Aluminium verwendet. Der Name des berühmten Tin Man aus Der Zauberer von Oz bezieht sich auf Weißblech, also verzinntes Eisenblech, das zum Beispiel für Konservendosen verwendet wird. In der deutschen Übersetzung heißt er deswegen einfach nur Blechmann, was leider nicht ganz so schön klingt.
Ausblick – das lernst du nach Zinn
Vertiefe dein Wissen über Metalle und ihre Eigenschaften! Nach Zinn kann es mit Blei und Eisen weitergehen. Tauche tiefer in die Welt der Chemie ein und erforsche die unglaublichen Möglichkeiten der Metallurgie!
Zusammenfassung – Zinn
- Zinn ist das chemische Element mit der Ordnungszahl $50$. Es ist ein Schwermetall mit relativ niedrigem Schmelzpunkt.
- Reines Zinn kann in drei verschiedenen Modifikationen vorliegen:
als$\alpha$‑Zinn, $\beta$‑Zinn und$\gamma$‑Zinn. - Historisch war Zinn vor allem als Teil von Bronze, also in Legierung mit Kupfer, von großer Bedeutung.
- Heute wird Zinn in technischen Anwendungen beispielsweise in Form von Lötzinn und Weißblech, in LCD-Displays oder in Farbpigmenten verwendet.
Häufig gestellte Fragen zum Thema Zinn
Transkript Zinn
Guten Tag und herzlich willkommen! Dieses Video heißt "Zinn". Dieses Video können sich alle Schülerinnen und Schüler vom 7. bis zum 12. Schuljahr anschauen. Ich sage, für wen was speziell vorgesehen ist. Der Film gehört zur Reihe Elemente. Die Vorkenntnisse sollten naturwissenschaftlich und chemisch entsprechend dem Schuljahr sein. Mein Ziel ist es, euch einen Überblick über die Eigenschaften, die Gewinnung und die Verwendung des chemischen Elements Zinn zu geben. Das Video besteht aus 10 Abschnitten: 1. Zinn im Periodensystem der Elemente 2. Die wichtigsten physikalischen Eigenschaften 3. Wichtige chemische Eigenschaften 4. Verwendung 5. Herstellung von Zinn 6. Die wichtigste Zinnlegierung 7. Die Zinnoxide 8. Zinngeschrei und Zinnpest 9. Der heutige Verbrauch 10. Perspektiven Dieser Abschnitt und die folgenden sind vorzugsweise für die Klassenstufen 7 und 8 gedacht. 1. Zinn im PSE, im Periodensystem der Elemente Die 5 chemischen Elemente Kohlenstoff, Silicium, Germanium, Zinn und Blei gehören der 4. Hauptgruppe des Periodensystems der Elemente an. Um die Eigenschaften von Zinn vorauszusagen, müssen wir uns an eine Gesetzmäßigkeit erinnern. Wir haben gelernt, dass der Metallcharakter in den Hauptgruppen von oben nach unten zunimmt. Kohlenstoff ist ein typisches Nichtmetall, Blei ist ein typisches Metall. Zinn steht direkt über dem Blei, ist somit auch ein Metall. Die Nummer der Hauptgruppe ist gleich der Zahl der äußeren Elektronen. Ein Zinnatom hat somit 4 Außenelektronen, man nennt sie auch Valenzelektronen. Anstelle dessen sagt man auch: Zinn hat die Wertigkeit 4. Folglich gibt es das Oxid SnO2. Ein Zinnatom ist mit 2 Sauerstoffatomen verbunden. Und das ist logisch, denn wir haben einmal gelernt, dass Sauerstoff zweiwertig ist. 2. Die wichtigsten physikalischen Eigenschaften Das chemische Symbol für Zinn Sn stammt vom lateinischen Wort Stannum. Und so sieht ein Zinnwürfel aus, schaut ihn Euch an. Bei Zinn handelt es sich um ein silberweißes Metall. Zinn ist sehr weich, es ist ein Schwermetall und hat eine Dichte von 7,265 Gramm pro cm³. Außerdem schmilzt Zinn niedrig bei 292 Grad Celsius. 3. Wichtige chemische Eigenschaften Zinn reagiert nicht mit Wasser, auf der Metalloberfläche bildet sich eine feste Oxidschicht, die das Metall vor weiterer Zersetzung schützt. Zinn reagiert sowohl mit Säuren als auch mit Basen. Ein solches Verhalten nennt man amphother. 4. Verwendung Das ist der letzte Abschnitt, der speziell für die Klassenstufen 7 und 8 vorgesehen ist. Zinn ist ein Element des Altertums, es wurde schon in der Bronzezeit verwendet. Auch später in der Antike wurden Gegenstände aus Bronze, die Zinn enthalten, gefertigt. Später stellte man Essgeschirr aus Hartzinn her. Das Lötzinn wird zum Weichlöten verwendet. Die Orgelpfeifen in Kirchenorgeln sind aus Zinn gefertigt. In geringen Mengen ist Zinn im Weißblech enthalten, die Oberfläche von Stahl wird mit Zinn versehen wie zum Beispiel bei der Rasselstein GmbH. Aus Weißblech werden Konservendosen hergestellt. In der Metalllegierung Nordisches Gold ist Zinn mit 1 % vertreten. Man findet diese Legierung in den 1- und 2-Euro-Münzen. 5. Die Herstellung von Zinn Dieser und die folgenden 3 Abschnitte sind speziell für die Jahrgangsstufen 9 und 10 vorgesehen. Es gibt nur wenige Erze, die Zinn enthalten. Eines davon ist Kassiterit, auch Zinnstein genannt. Kassiterit besteht hauptsächlich aus Zinn (IV)-Oxid. Bei der Herstellung wird Zinn (IV)-Oxid mit Kohlenstoff versetzt. Es bildet sich Zinn und Kohlenstoffdioxid wird als Nebenprodukt frei. Das Oxid wird mit Kohlenstoff reduziert. 6. Die wichtigste Zinnlegierung Was versteht man unter einer Legierung? Eine Legierung ist eine feste Lösung zweier, manchmal auch mehrerer Metalle. Eine solche Lösung erhält man, wenn man Kupfer mit Zinn legiert. Im Ergebnis erhält man Bronze. Bronze ist vielleicht nicht die wichtigste Legierung vom wirtschaftlichen Standpunkt, aber mit Sicherheit vom geschichtlichen. Im 17. Jahrhundert gab es bereits Bronzemanufakturen. Heute wird Bronze vorzugsweise in der Kunst verwendet, für Skulpturen, Monumente, Grabmäler und Pokale. In der Technik findet Bronze für spezielle Lager Verwendung. 7. Die Zinnoxide Über Zinn (IV)-Oxid haben wir bereits gesprochen. Es gibt aber auch das Zinn (II)-Oxid, in dem das Zinn zweiwertig ist. Wir merken uns, ein Oxid kann der maximalen Wertigkeit entsprechen. Die Wertigkeit kann aber auch niedriger sein. 8. Zinngeschrei und Zinnpest Die 3 letzten Abschnitte sind speziell für die Jahgangsstufen 11 und 12 vorgesehen. Wie kann es sein, dass Zinn in lautes Geschrei ausbricht? Doch keine Angst, gebrüllt wird hier nicht. Es handelt sich eher um ein dezentes Geräusch. Dieses wird hörbar beim Verbiegen eines Zinngegenstandes. Der zweite Begriff hatte mitunter spektakuläre Auswirkungen. Der Begriff Zinnpest steht in engem, spektakulärem Zusammenhang mit einem Ereignis aus der Weltgeschichte. Es geht hier um Robert F. Scott und seine Südpolarexpedition in den Jahren 1911/1912. Die Brennstoffkanister gingen an den Nahtstellen entzwei, die mit Zinn verlötet waren. Der Brennstoff ging verloren, das war einer der Gründe für den Tod aller Expeditionsmitglieder. Die Ursache besteht darin, dass Zinn in 2 unterschiedlichen Formen auftritt, nämlich als Alpha- und Beta-Zinn. Man spricht hier auch von allotropen Modifikationen. Beta-Zinn ist metallisch, wir kennen es als normales Zinn oberhalb von 13 Grad Celsius. Bei Abkühlung unterhalb 13 Grad Celsius findet eine Umwandlung in Alpha-Zinn statt. Das ist ein Pulver. Der Prozess selbst wird als Zinnpest bezeichnet. Gegenmittel gegen die Zinnpest sind Legierungen mit Bismut oder Antimon. 9. Der heutige Verbrauch In der Erdkruste ist Zinn wenig vorhanden, nur 2,3 ppm. Die Ausbeutung der Erdkruste beträgt 370.000 Tonnen pro Jahr. Die aktuellen Reserven liegen bei 5,6 Millionen Tonnen. Weil der Bedarf an Zinn steigt, wird es zu einer Zinnverknappung kommen. 80% des Zinns gewinnt man aus Sekundärlagerstätten, sogenannten Seifen. Diese Art der Gewinnung findet hauptsächlich in Mittelchina, Thailand und Indonesien statt. Der Marktpreis für Zinn betrug im Jahr 2003 nur 5.000 Dollar und schnellte bis 2008 auf 24.000 Dollar hoch. Mitte November 2011 befand er sich bei 22.000 Dollar. Die größten Zinnverbraucher der Welt sind China, USA, Japan und Deutschland. Der Verbrauch an Zinn schlüsselt sich so auf: 35% Lote, 30% Weißblech und 30% Chemikalien und Pigmente. 10. Perspektiven Das chemische Element Zinn verfügt über ein großes Anwendungsspektrum. In Polymeren wie PVC wirkt es als Stabilisator. Als Oxid verwendet man es als Poliermittel. Zinnoxid mit Indiumoxid wird in LCD-Displays verwendet. Zinnverbindungen findet man in Anstrichmitteln als Antifouling bei Schiffen, und nicht zu vergessen die Zinnfiguren und Lametta. Es ist zu befürchten, dass es langfristig zur einer weiteren Verteuerung des Zinns kommt. Damit nimmt die Bedeutung des Recycling immens zu. Man wird nicht umhinkommen, auch nach alternativen Lösungen zu suchen. Ich danke für Eure Aufmerksamkeit, alles Gute, auf Wiedersehen.
Zinn Übung
-
Beschreibe die Stellung des Zinns im Periodensystem.
TippsNutze ein Periodensystem der Elemente zur Überprüfung der Aussagen.
LösungZinn hat die Ordnungszahl $50$ und ist in der 4. Hauptgruppe im Periodensystem der Elemente zu finden. Weitere Elemente der Kohlenstoffgruppe sind $\ce{C}$, $\ce{Si}$, $\ce{Ge}$ und $\ce{Pb}$. Sie alle haben 4 Valenzelektronen und können somit bis zu vier Bindungen eingehen. Mögliche Oxide des Zinns sind $\ce{SnO2}$ oder $\ce{SnO}$. Da der Metallcharakter innerhalb einer Hauptgruppe von oben nach unten zunimmt, gehört Zinn zu den Metallen.
-
Erkenne die chemischen und physikalischen Eigenschaften des Zinns.
TippsChemische Eigenschaften beziehen sich auf das Reaktionsverhalten des Zinns.
LösungAls physikalische Eigenschaften bezeichnet man Werte, die man durch Messungen und Experimente erhalten und physikalischen Größen zuordnen kann. Neben der silbrig glänzenden Farbe der Metalle wird auch die Mohshärte betrachtet. Bei Zinn liegt diese bei $1,5$, weshalb Zinn zu den weichen Stoffen gehört. Ebenfalls wichtig ist die Dichte. Da die von Zinn bei etwa $\pu{7,3 g//cm^3}$ liegt, ist Zinn ein Schwermetall. Weiterhin ist dieser Stoff niedrig schmelzend, da dieser Effekt bereits bei $\pu{292 °C}$ zu beobachten ist.
Betrachtet man die chemischen Eigenschaften, so fällt auf, dass Zinn amphoter ist, d.h. es kann als Säure oder Base fungieren (und somit Protonen aufnehmen oder abgeben). Ebenfalls wichtig ist, dass Zinn an der Oberfläche eine feste Oxidschicht bildet.
-
Erkläre das Experiment „Zinngeschrei“.
TippsBeschreibe, was bei der Durchführung des Experiments mit dem Gitter passiert.
LösungDie drei Modifikationen haben unterschiedliche Kristallgitter: $\alpha$-Zinn besitzt ein kubisches Diamantgitter, $\beta$-Zinn ein verzerrt oktaedrisches Gitter und $\gamma$-Zinn ein rhombisches Gitter.
Diese Gitterstruktur ist der Grund für das Knirschen, wenn ein Zinnstab gebogen wird. Es kommt zur Verschiebung des Kristallgitters, wodurch die Kristalle aneinander reiben.
Zinngeschrei ist nur bei reinem Zinn und nicht bei seinen Legierungen zu hören.
-
Formuliere die Reaktionsgleichungen der Zinnverbindungen.
TippsReaktionsgleichungen werden ausgeglichen durch Auszählen der Atome jedes Elements auf beiden Seiten des Reaktionspfeils.
LösungZinn reagiert mit Salzsäure zu Zinn(II)-chlorid und einem Mol Wasserstoff. Da Zinnchlorid hier zwei Atome Chlor besitzt, müssen zwei Mol $\ce{HCl}$ eingesetzt werden.
Zinn(II)-chlorid ist ein Salz und kann dann zum Beispiel mit Natriumhydroxid reagieren. Dabei entstehen neben Zinn(II)-hydroxid zwei Mol Natriumchlorid. Um richtig auszugleichen, muss auf der Eduktseite $\ce{2NaOH}$ in eine Lücke eingetragen werden. Zinn(II)-hydroxid ist schwer wasserlöslich und fällt daher bei dieser Reaktion als weißer Niederschlag aus.
Zinn(II)-hydroxid kann ebenfalls mit Natronlauge reagieren. Weil das dadurch entstehende Natriumstannat zwei Atome Natrium enthält, muss auch hier wieder in eine der Lücken bei den Ausgangsstoffen $\ce{2NaOH}$ eingesetzt werden.
-
Bestimme Eigenschaft oder Anwendung der folgenden Stoffe.
TippsZinn bleibt bei Legierungen mit Bismut auch bei niedrigen Temperaturen stabil.
LösungDa Zinn in der vierten Hauptgruppe steht, besitzt es 4 Valenzelektronen. Es ergeben sich daraus die Verbindungen Zinn(II)- und Zinn(IV)-oxid. Letzteres liegt als Zinnstein-Erz (Kassiterit) vor. Zinn(II)-oxid weist, wie der Name es beinhaltet, dagegen nur eine Wertigkeit von 2 auf.
$\ce{Cu}$ und $\ce{Sn}$ bilden die Legierung Bronze. Sie wird in der Kunst verwendet, bei Grabmälern oder zur Herstellung von Pokalen. Zinn hat zwei Modifikationen: $\alpha$ und $\beta$. Letztere liegt vor, wenn Zinn einer Temperatur von über 13 °C ausgesetzt ist. Bei geringeren Temperaturen liegt die $\alpha$-Modifikation vor.
-
Erläutere Napoleons Problem mit Zinn.
TippsBei einer kleineren Dichte benötigen gleich viele Teilchen ein größeres Volumen.
LösungDa sich die Feldzüge vom Sommer bis zum Winter hinzogen, wurden die Soldaten mit der Zeit sinkenden Temperaturen ausgesetzt. Diese führten zur Umbildung vom $\beta$-Zinn in den $\alpha$-Zinn. Letzteres hat mit einer Dichte von $\pu{5,8 g//cm^3}$ eine geringere Dichte als die $\beta$-Form $\left( \pu{7,3 g//cm^3} \right)$. Sie benötigt somit mehr Platz für die gleiche Anzahl Zinnatome, was zur Folge hat, dass sich auf Zinnoberflächen (wie zum Beispiel Knöpfen) durch Aufbrechen der Kristallstrukturen Blasen bilden, die bei Berührung leicht zerspringen und dann in Form von Pulver vorliegen.
9.718
sofaheld-Level
6.600
vorgefertigte
Vokabeln
8.277
Lernvideos
38.579
Übungen
33.616
Arbeitsblätter
24h
Hilfe von Lehrkräften

Inhalte für alle Fächer und Klassenstufen.
Von Expert*innen erstellt und angepasst an die Lehrpläne der Bundesländer.
Testphase jederzeit online beenden
Beliebteste Themen in Chemie
- Periodensystem
- Ammoniak Verwendung
- Entropie
- Salzsäure Steckbrief
- Kupfer
- Stickstoff
- Glucose Und Fructose
- Ethansäure
- Salpetersäure
- Redoxreaktion
- Schwefelsäure
- Natronlauge
- Graphit
- Legierungen
- Dipol
- Molare Masse, Stoffmenge
- Sauerstoff
- Elektrolyse
- Bor
- Alkane
- Verbrennung Alkane
- Chlor
- Elektronegativität
- Tenside
- Toluol, Toluol Herstellung
- Wasserstoffbrückenbindung
- fraktionierte Destillation
- Carbonsäure
- Ester
- Harnstoff, Kohlensäure
- Reaktionsgleichung Aufstellen
- Redoxreaktion Übungen
- Stärke und Cellulose Chemie
- Süßwasser und Salzwasser
- Katalysator
- Ether
- Primärer Alkohol, Sekundärer Alkohol, Tertiärer Alkohol
- Van-der-Waals-Kräfte
- Oktettregel
- Kohlenstoffdioxid, Kohlenstoffmonoxid, Oxide
- Alfred Nobel
- Wassermolekül
- Ionenbindung
- Phosphor
- Saccharose Und Maltose
- Aldehyde
- Kohlenwasserstoff
- Kovalente Bindung
- Wasserhärte
- Peptidbindung


 5 Minuten verstehen
5 Minuten verstehen
 5 Minuten üben
5 Minuten üben
 2 Minuten Fragen stellen
2 Minuten Fragen stellen

 Bereit für eine echte Prüfung?
Bereit für eine echte Prüfung?








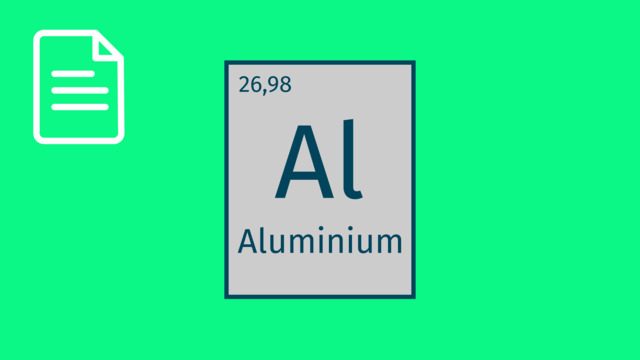














toll mega hip mafaggaz